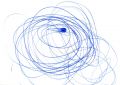| Term | Main definition |
|---|---|
| verschieden geformte Kritzel |
|
| Streubild | Eine Raumkonzeption ist nicht zu erkennen. Die Figuren und Gegenstände werden willkürlich auf der Bildfläche verteilt. |
| Streifenbild | Der untere Rand wird mit einem Streifen versehen, wobei das Grün Gras und das Braun Erde bedeutet. Im Verlauf der Entwicklung erweitert sich der Streifen zunehmend nach oben. Auch hier wird der Himmel am oberen Blattrand angebracht. |
| Standlinienbild | Figuren und Gegenstände werden auf den unteren Blattrand gestellt. Der Himmel wird an den oberen Rand gesetzt. |
| Standflächenbild | Das gesamte Blattformat bildet die Standfläche, auf der Figuren und Gegenstände Platz finden. Der Himmel fehlt. |
| Spurschmieren | siehe: Schmieren |
| Spurkritzel | |
| sinnunterlegtes Kritzeln |
|
| Simultanbild | Befindet sich auf ein und demselben Bild eine bestimmte Person zwei- oder mehrmals, dann wird ein Vorgang beschrieben. Der zeitliche Ablauf erfolgt demnach in einem unverändert gleich bleibenden Raum, d. h. der Verlauf des Geschehens wird in zeitlichen Phasen durch eine Figur im Bild gegliedert. |
| Sensomotorik | Zusammenwirken von Bewegung und den Wahrnehmungssinnen wie sehen, hören, tasten usw. |
| Schwing- oder Schwungkritzel | |
| Schreibkritzel | |
| Schmieren | Phase der Kinderzeichnung bis zu einem Alter von etwa 18 Monaten. Kleinkinder bearbeiten gerne flüssige oder breiartige Substanzen und schmieren mit den Fingern darin. |
| Schließungstendenz | Sie taucht vor allem im Übergang vom Kopffüßler zur gegliederten Vollform der menschlichen Gestalt auf. Der offene Raum zwischen den Beinen wird mit einem Strich geschlossen. Die Schließungstendenz taucht phasenweise auf und betrifft auch andere Motive. Solange die Lücke noch Störfaktor ist, drängt alles auf ihre Beseitigung (Mühle 1975, S. 34). |
| Schließungskritzel | |
| Schema, Schemazeichen | Haben die Kinder eine endgültige Gestaltung eines Motivs, sei es für Mensch, Haus, Baum, usw. entwickelt, verwenden sie diese ständig, bis sie automatisch verfügbar ist. Das heißt, die Kinder müssen überhaupt nicht mehr nachdenken, wie dieses Motiv gezeichnet werden muss. Um sich dieses Phänomen zu veranschaulichen, braucht man nur einmal einen beliebigen Buchstaben in die Luft zu schreiben. Dass über die Form des Buchstabens dabei nicht nachgedacht wird, kennzeichnet die automatische Verfügbarkeit. |
| sachlicher Anlass | Ein Gegenstand oder ein Sachverhalt wecken das Interesse der Kinder, die mit der Zeichnung eine möglichst objektive Darstellung anstreben. Jüngere Kinder erfassen dabei oft nur einen einzelnen oder nur wenige sachliche Aspekte des Objektes bzw. der Situation. (siehe Akkommadation und Assimilation) Mit solchen Zeichnungen setzen sich Kinder mit der erfahrbaren Wirklichkeit auseinander, eignen sich in der Form eines frühen analytischen Denkens Wirklichkeit sozusagen gedanklich an. |
| Rundformen | „Runde Formen tauchen nach und nach [...] auf. Zunächst sind es Linien, die im Kreis herumführen – Spuren der entsprechenden Armbewegung. Sie zeigen das Glätten oder Vereinfachen von Kurven, das eine gewisse motorische Übung immer mit sich bringt. Jede Tätigkeit mit den Händen gelangt nach einiger Zeit zu fließenden Bewegungen [...]. Die Hebelanordnung der menschlichen Glieder erleichtert runde Bewegungen. Der Arm dreht sich um das Schultergelenk, und feinere Drehbewegungen werden vom Ellbogen, dem Handgelenk und den Fingern besorgt. Die ersten Kreisbewegungen verraten also einen Organisationsprozess der Motorik nach dem Prinzip der Einfachheit." (Arnheim 2000, S. 171) |
| Richtungszusammenhang | Organisch erscheinender Übergang z. B. von Körper zu Armen und Beinen, von Stamm zu Ästen. Diese Lösung wird erst mit dem Jugendalter erreicht, macht sich aber bereits in der späten Kindheit bemerkbar. |
| Richtungsdifferenzierung | Die Abweichung von der Hauptrichtung wird mit einem schrägen Winkel gezeichnet. |
| R-Prinzip | Prinzip der radikalen Richtungsunterscheidung. Äste am Baumstamm, Arme an der menschlichen Figur, der Kamin auf dem Dach usw. stehen in der frühen Zeichenphase im rechten Winkel zur betreffenden Grundlinie. „Der rechte Winkel ist eines der ersten und primitivsten Zeichenelemente für die Darstellung des Zueinanders von Gestaltgliedern.“ (Mühle 1975, S. 90) |
| Profilwende | Bezeichnet die Entwicklung der Gesichtsdarstellung vom En Face zum Profil. Die Übergangsphase ist von dem sogenannten gemischten Profil gekennzeichnet. Folgende Unterscheidungen sind bekannt:
|
| Pantomimische Bewegungsdarstellung/symbolische Motorik | Sonderform des Aktionszeichen. Es handelt sich dabei um einen pantomimischen Zeichenakt (Mühle 1971 , Seite 72). Das heißt: das Kind vollzieht eine reale Bewegung in der Zeichnung nach. So wird z. B. das Stechen einer Mücke nachgeahmt, indem das Kind mit einem Stift in das Blatt Papier sticht. "Als Beobachter hat man in solchen Fällen deutlich den Eindruck, dass hier die Zeichenbewegung Darstellungsfunktion hat." (Muchow 1926, S. 94) |
| orthoskopische Darstellung | Die Gegenstände werden in ihrer anschaulichsten Ansicht wiedergegeben. So kommt es vor, dass Seiten-, Vorder- und Aufsicht miteinander dann vermischt werden, wenn die einzelnen Teile des Motivs in jeweils einer anderen Ansicht am anschaulichsten erscheinen. |
| motorischer Anlass | Das Bedürfnis und die Lust, Bewegungen auszukosten, bestimmt vor allem die Kritzelphase. |
| Mischform von Standlinienbild/Streifenbild und Standflächenbild | |
| Mehrstreifenbild | Zwei oder mehrere Streifen gliedern das Blatt. Diese relativ seltene Raumdarstellung verwenden Kinder, wenn die Breite des Blattformats nicht genügend Platz bietet. |
| materialer Anlass | Amorphes Material wie Sand, Ton, gerissenes Papier, Stoffreste oder beliebige Fundstücke, wie verbrauchtes Verpackungsmaterial, verwelkte Blätter, aber auch Klebstoff und Schere reizen die Kinder zu einem experimentellem Umgang, d. h. zu einem offenen Handlungsprozess, ohne dass die Absicht besteht, etwas Bestimmtes darzustellen. Beim materialen Anlass spielt auch der haptische Reiz, der durch das Material angesprochen wird, eine wichtige Rolle. |
| malerischer Typ | Individuelle Gestaltungsanlage. Die individuellen Gestaltungen der Kinder lassen sich bestimmten typenmäßigen Veranlagungen zuordnen, unter denen die zwei extremen Pole des linearen und malerischen Typs relativ häufig sind (vgl. linearer Typ und malerischer Typ: Heinrich Wölfflin, 1915). Der malerische Typ denkt in Flecken und Flächen, der lineare in Formen und Linien. Der Prozess beim malerischen Typ ist offen. Auf Konturlinien nimmt er kaum Rücksicht. Die Typenzuordnung ist nicht auf die Kunstgattungen Malerei und Zeichnung bezogen. So zeigt sich z. B. der malerische Typ auch in der Zeichnung. |
| linearer Typ |
|
| Leitqualitaet des Erlebens | Ist ein Kind von einem bestimmten Erlebnis beeindruckt bzw. fasziniert, so wird der für das Erlebnis dominierende Aspekt besonders betont, d. h. andere Momente des Erlebnisses werden kaum beachtet und nicht selten in der Zeichnung gänzlich ausgeblendet. |
| Landkartenbild | Sonderform des Standflächenbildes. Straßen, Eisenbahnschienen und Flüsse werden wie auf einer Landkarte in der Fläche ausgebreitet. Stehen die Gegenstände im rechten Winkel zur Standfläche und zeigen sie dementsprechend im Gesamtbild in verschiedene Richtungen, liegt hier die Aufrichtungstendenz vor. Dafür wird in der Fachliteratur auch der Begriff des Klappbildes bzw. der Umklappung verwendet. Zeigen dagegen alle Figuren und Gegenstände eine senkrechte Ausrichtung nachoben im Format, liegt eine Gesamtaufrichtung vor. |
| Kritzelzeichen | Verschiedene Kritzel, die sich in der Kindheitsentwicklung über einzelene Stufen von der Grobmotorik bis zur Feinmotorik beobachten lassen. Dazu gehören Spurkritzel, Hiebkritzel, Schwing- oder Schwungkritzel, Kreiskritzel, verschieden geformte Kritzel, sinnunterlegtes Kritzeln und Schreibkritzel. Die Kritzelzeichen werden allmählich dem motorischen Gedächtnis eingeprägt und sind dann automatisch verfügbar. Bislang wenig erfasst sind zufällige Spurkritzel, die sich jeder Wiederholung, also einem Lernprozess entziehen. (Vgl. Hans Meyers, 1957) |
| Kreiskritzel | |
| Kopffüßler |
|
| intrinsische Motivation | Anlass, der aus eigenem, inneren Antrieb heraus begründet ist. |
| Hiebkritzel | |
| gegliederte Vollform | |
| gegliederte Figur | |
| Füllungstendenz | In der Weiterentwicklung zum Kreis verdichten sich die Striche des Kreiskritzels in der Randzone. Was früher wie ein Strich-Knäuel aussah, erweckt jetzt den Eindruck eines Kreises, den die Kinder noch nicht als geometrische Form erfassen, sondern als Raum. Dieser wird mit einem Schließungskritzel geschlossen. Weiterhin macht sich das Bedürfnis bemerkbar, den Raum zu füllen. |
| extrinsische Motivation | Anlass, der durch eine andere Person vorgegeben wird, wie z. B. ein Auftrag oder wie er durch eine Situation erforderlich wird. |
| emotionaler Anlass | Ein Erlebnis, eine Erfahrung oder eine Situation rufen ein Gefühl wie Freude, Trauer, Wut, Zuneigung usw. hervor, das in einer Zeichnung ausgedrückt wird. Die Kinder artikulieren ihre Gefühle und lernen dabei, mit ihren Gefühlen umzugehen. |
| Eindrucksdominante | Ist |
| Bedeutungsproportion | Erscheint einem Kind eine Figur oder ein Gegenstand besonders bedeutsam, zeichnet es die Figur bzw. den Gegenstand im Vergleich zu den anderen Darstellungen im Bild besonders groß. Das kann auch Details betreffen. So werden manchmal Hände besonders groß gezeichnet, wenn die betreffende Figur mit den Händen etwas Wichtiges tut. |
| ästhetisch | Die Wahrnehmung betreffend. Der Begriff Ästhetik (von griech. aísthēsis „Wahrnehmung“, „Empfindung“) wird in der Fachterminologie ab dem 19. Jh. nicht mehr als Wert-, sondern als Funktionsbegriff verwendet. |
| Assimilation | (Franz., Angleichung) Zuordnung einer Wahrnehmung zu einem bereits bestehenden Schema. Z. B. ordnet ein Kind mithilfe von Erwachsenen einen Dackel und einen Dalmatiner dem Schema "Hund" zu. Nach Jean Piaget ist der Gegenpart zur Assimilation die Akkomodation. Beide Arten der kognitiven Anpassung (Adaption) führen zu einem Gleichgewichtszustand. |
| Aktionskritzel | Solange die Kinder die Bewegungsdarstellung noch nicht beherrschen, verwenden sie für Vorgänge, Handlungen und Bewegungen die sogenannten Aktionskritzel. Bei manchen Kindern wird dies bis weit in das Grundschulalter beibehalten. |
| Akkomodation | Wenn eine Wahrnehmung nicht in ein vorhandenes Schema eingeordnet werden kann, enwickelt das Kind ein neues Schema dafür oder modifiziert ein vorhandenes. Lässt sich z. B. eine Katze dem Schema "Hund" nicht zuordnen, akkomodiert das Kind und bildet ein neues Schema "Katze". Nach Jean Piaget ist der Gegenpart zur Akkomodation die Assimilation. Beide Arten der kognitiven Anpassung (Adaption) führen zu einem Gleichgewichtszustand. |
| Adaption | (Auch Adaptation, von lat. adaptare) Anpassung oder Angleichung eines Kindes an seine Umwelt. Nach Jean Piaget (Entwicklungspsychologie) existieren zwei Erscheinungsformen der Adaption: Assimilation und Akkomodation. |
Forschungsportal Bilderwelten von Kindern und Jugendlichen